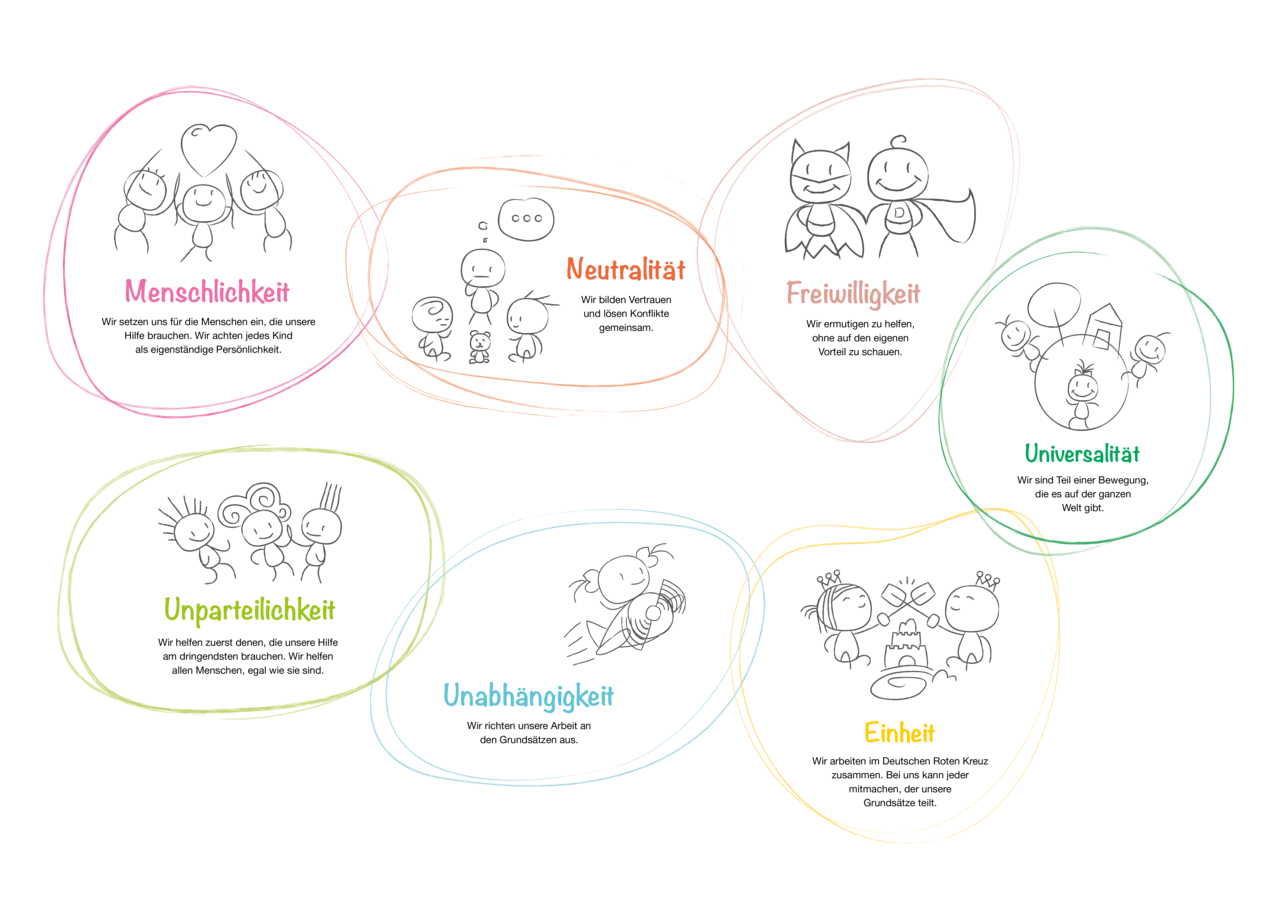Ich stehe vor dem Eingang zur OMEP-Konferenz – das große Konferenzhotel betrete ich in dem Bewusstsein, gleich auf eine weltweite Gemeinschaft zu treffen, die Bildung als Recht des Kindes umsetzt.
OMEP – das steht für Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire. Seit 1948 setzt sie sich international für das Recht auf frühkindliche Bildung ein – mit nationalen Komitees in über 70 Ländern, darunter auch Deutschland. Es geht dabei nicht nur um Kindertageseinrichtungen, sondern um das große Ganze: Wie gelingt Bildung von Anfang an – inklusiv, gerecht, kindgerecht, kulturell verwurzelt?
Kunst, Kultur und Teilhabe – das Konferenzmotto wird lebendig
Die Konferenz in Bologna steht unter dem Motto: „Kunst und Kultur in der frühkindlichen Bildung: Spiel, Ausdruck, Teilhabe“ Und genau das wird hier gelebt.
In Vorträgen, Workshops und Diskussionen treffen über 800 Menschen aus allen Kontinenten aufeinander – Pädagoginnen und Pädagogen, Forschende, Interessierte. Sie sprechen über das Spiel als Bildungserfahrung, über kulturelle Ausdrucksformen von Kindern, über kreative Lernräume und über Teilhabe als gelebte Demokratie von und mit Kindern.
Es geht um Vielfalt. Um Menschenwürde. Um Zukunft.
Wir sind hier, mit einem Team aus dem Deutschen Nationalkomitee einen Workshop anzubieten. Das deutsche OMEP-Komitee ist bei der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe im Fachausschuss „Kindheit, Kinderrechte und Familienpolitik“ angesiedelt.

Zwei Systeme, ein Ziel – Schule und Jugendhilfe im Dialog
Unser Thema:
„Lesen, Schreiben, Rechnen … sonst noch was?“
Ein ehrlicher Blick auf die Zusammenarbeit von Schule und Kinder- und Jugendhilfe.
Denn so sehr wir uns bemühen – oft prallen hier zwei Welten aufeinander. Schule mit klaren formalen Leistungszielen, die Jugendhilfe mit einem offenen, lebensweltbezogenen Bildungsverständnis. Beide haben ihre Berechtigung. Aber noch zu oft fehlt der echte Dialog. Ich gehe in den Workshop – mit Neugier, vielleicht auch einem Hauch Skepsis. Was kann man in einer Stunde schon wirklich bewegen?. Doch dann, nach einer sehr kompakten Vorstellung über unser System und den Herausforderungen, vor denen wir stehen, kommen wir mit den Teilnehmenden an Tischen ins Diskutieren.
Teilnehmende aus Nigeria, Finnland, Dänemark, Tschechien, Armenien und den USA bringen sich ein. Die meisten kennen ähnliche Herausforderungen. Und plötzlich entsteht ein Raum, in dem nicht nur etwas vorgetragen, sondern sich zugehört und miteinander diskutiert wird. Wir tauschen aus, was funktioniert – und was nicht.
Es geht um Übergänge von der Kita in die Grundschule. Um Ganztagsbildung als Chance zur Verbindung. Um die Frage, wie es Kita und Schule gemeinsam gelingen kann, wachsende Bildungsungleichheiten auszugleichen.
Zwischen Tests und Teilhabe – internationale Bildungsansätze im Vergleich
Das Thema ist überall relevant – ganz unabhängig davon, wo man lebt, auch wenn die Bildungssysteme sich stark unterscheiden. Während in Deutschland gerade darüber diskutiert wird, alle Vierjährigen auf ihren Sprach- und Entwicklungsstand zu testen, gehen andere Länder einen ganz anderen Weg: In Skandinavien zum Beispiel schafft man solche Tests wieder ab, weil sie aus pädagogischer Sicht nicht zum eigentlichen Ziel passen. Auch in Tschechien wird auf verpflichtende Tests verzichtet. Stattdessen setzen diese Länder auf eine regelmäßige Beobachtung und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit.
Erfahrungen zeigen: Man kann auch ohne aufwendige Tests gut inklusiv arbeiten. Die Kolleginnen aus Helsinki geben uns dazu einen genaueren Einblick in ihren Evaluationsbogen und ihr inklusives Curriculum („Helsinki’s curriculum for early childhood education 2022“). Besonders in der finnischen Hauptstadt leben viele Kinder, die unterschiedliche Muttersprachen sprechen – das prägt den Alltag und stellt das Bildungssystem vor besondere Herausforderungen.
Das Curriculum legt deshalb großen Wert darauf, nicht nur Finnisch, sondern auch andere Sprachen zu fördern. Denn Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, lernen Sprache anders als einsprachige Kinder. Sprachstandserhebungen orientieren sich meistens an einsprachigen Kindern – und führen dadurch oft ungewollt zu Ausgrenzung. In Helsinki verzichtet man bewusst auf solche Tests. Stattdessen schafft man ein möglichst sprachanregendes Umfeld mit verschiedenen Materialien und bezieht die Eltern aktiv mit ein. Und das mit Erfolg.

Ein Gefühl, das bleibt – frühe Bildung, Erziehung und Betreuung als gemeinschaftliche Aufgabe
Natürlich ist eine Stunde zu wenig, um so richtig in die Tiefe zu gehen. Wir verabreden uns, mit einigen Teilnehmenden den Austausch über Online-Meetings weiterzuführen. Wir können viel lernen voneinander darüber, wie wir möglichst förderliche Bedingungen für alle Kinder für den Übergang von der Kita in die Schule schaffen.
Am Ende verlasse ich den Raum mit einem Gefühl, das mich tief berührt: Wir sind viele. Und wir können etwas bewegen. Weltweit.
Die OMEP hat mir mit dieser Konferenz gezeigt, was Bildung eigentlich sein sollte:
Ein gemeinsamer Prozess – getragen von Vielfalt, von echter Beziehung zu dem, was Kinder in ihrer Entwicklung brauchen.
Und Bologna?
War nicht nur Gastgeberstadt - mit dem Empfang bei der Bürgermeisterin und der Möglichkeit mit Pädagoginnen und Pädagogen in den Kitas der Stadt ins Gespräch zu kommen - auch ein lebendiges Beispiel für Wandel, für Wärme und für die Kraft, die entsteht, wenn Menschen sich über gemeinsame Ziele zum Wohle der kommenden Generation austauschen.