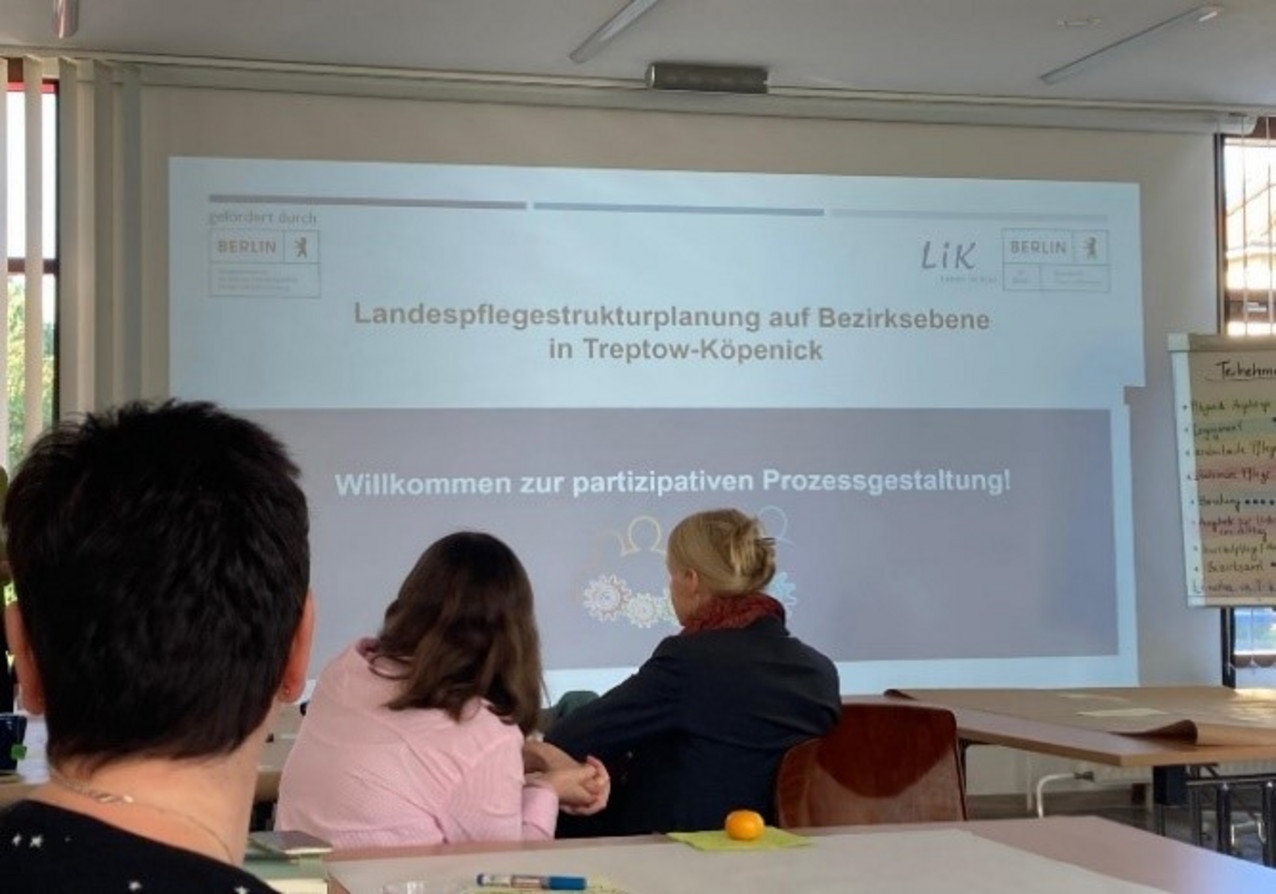Gemeinde-basierte Versorgung: Die Wohlfahrt als Ressource der gesundheitlichen Daseinsfürsorge
Freie Wohlfahrtspflege – Hilfe zur Selbsthilfe für die Gesellschaft
Der deutsche Sozialstaat zeichnet sich durch das sogenannte Subsidiaritätsprinzip aus, wonach die nächsthöhere Ebene des Gesellschaftssystems erst dann zum Tragen kommt, wenn die darunter liegende nicht funktioniert. Vor dem Hintergrund des Sozialstaatsgebots gründet sich darauf die Existenz der Wohlfahrtsverbände, die ihre Arbeit als gesellschaftliche Selbsthilfe verstehen [1].
Insofern gilt es den Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege Vorrang gegenüber den staatlichen - aber auch privatwirtschaftlichen Strukturen einzuräumen [2], ohne jedoch die Souveränität des Staates als Vollzugsorgan oder Ausfallsbürgen in Frage zu stellen. Die grundgesetzlich verankerte Verantwortung des Staates für die Daseinsfürsorge kann (und soll) nicht delegiert werden, auch nicht an die Wohlfahrtsverbände.
Exkurs: Daseinsfürsorge ist ein Grundrecht Aller [3, 4]
In dem Föderalismus der Bundesrepublik Deutschland tragen die Kommunen die Verantwortung für die Daseinsfürsorge. Dies ergibt sich weniger aus einer spezifischen Vorschrift heraus, sondern eher indirekt, durch das Zusammenwirken des Grundgesetzes, wie dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20, I GG), der Garantie der kommunalen Selbstverwaltung (Art. 28, II GG), sowie in Bezug auf die Gesundheit aus weiteren Grundrechten, z.B. der Menschenwürde (Art. 1, I GG), oder dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2, II GG).
Die weitgehende, rechtliche Unbestimmtheit der Daseinsfürsorge führt in der Praxis dazu, dass jede Kommune ein Stück weit selbst festlegt, welche Aufgaben sie konkret aufgreift. Das Spektrum an Betätigungsfeldern reicht hierbei von der Energie- und Wasserversorgung, über die Abwasser- und Abfallentsorgung, bis hin zum öffentlichen Nahverkehr und sozialen Wohnungsbau; aber auch Bildung, Sport, Kultur, und eben die Gesundheitsversorgung gehören dazu.
Angesichts dieser Aufgabenvielfalt versteht es sich von selbst, dass es auf die Entscheidungstragenden vor Ort ankommt, in welchen Feldern sich die jeweiligen Kommunen (besonders) engagieren. Insofern unterliegt die kommunale Daseinsfürsorge ein Stück weit den regionalen politischen Interessens- und Kräfteverhältnissen.
Gesundheitsfürsorge – Verantwortung ohne Zuständigkeit
Bei der gesundheitlichen Daseinsfürsorge kommt hinzu, dass die Kommunen über nur geringe Steuerungsmöglichkeiten verfügen. Dies rührt daher, dass sich die wesentlichen Steuerungsmechanismen des deutschen Gesundheitssystems auf die Ausgestaltung der Kranken- und Pflegeversicherung beziehen, für die der Bund zuständig ist. Üblicherweise gibt der Bund über die Sozialgesetzgebung jedoch lediglich einen groben Rahmen vor, der dann durch die Partner der Selbstverwaltung konkretisiert und mit Leben gefüllt wird [3].
Insofern sind den Kommunen bei der Erfüllung ihres Auftrags ein Stück weit die Hände gebunden. Denn die Angebotsstruktur an Gesundheitsdienstleistungen vor Ort kann lediglich indirekt beeinflusst werden, etwa über divers gelagerte Anreize (Ökologie, Infrastruktur, Bildung usw.) [3]. Letztendlich stehen die Kommunen aber damit im Wettbewerb zueinander, was gerade in strukturschwachen Räumen erhebliche Herausforderungen für die Angebotsgestaltung mit sich bringt. So ist es nicht verwunderlich, dass es gerade diese Räume sind, die zur Unterversorgung neigen, während in strukturstarken Regionen eher von einer Überversorgung ausgegangen werden kann [5, 6].
Gleichzeitig steht das deutsche Gesundheitswesen vor großen Umbrüchen. Die Alterung der Gesellschaft, die Zunahme von chronischen Erkrankungen, die steigende Zahl pflegebedürftiger Menschen, die Folgen des Klimawandels, der Fachpersonenmangel, das arztzentrierte Gesundheitssystem, die Versäulung der Versorgungssektoren, die unkoordinierten Behandlungswege, die Nachwirkungen von COVID-19; all diese Faktoren implizieren grundlegende Reformen in der Ausgestaltung und Organisation der Gesundheitsversorgung [4, 7].
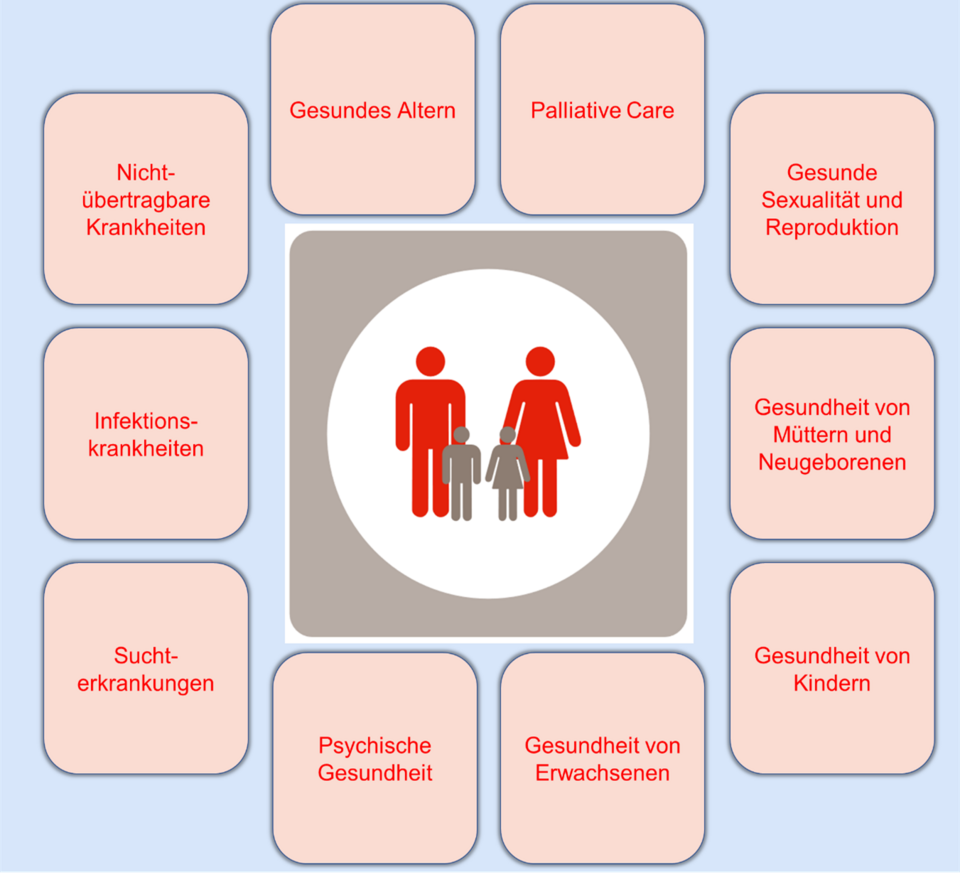
Gemeinde-basierte Versorgung – Gesundheit für Alle
Ein vielzitierter Ansatz, um vielen dieser Probleme zu begegnen, ist die sogenannte gemeindebasierte Versorgung [engl. community-based care] [8]. Kerngedanke ist, dass Gesundheit da am besten gefördert, erhalten und wiederhergestellt werden kann, wo die Menschen leben; in ihrer Gemeinde vor Ort. Gemeinde-basierte Versorgungsmodelle entstammen aus einer anglo-amerikanischen Public Health Tradition und zeichnen sich durch Niedrigschwelligkeit, Wohnortnähe, Bedarfsgerechtigkeit und koordinierte, interprofessionelle Versorgungswege aus.
Die Angebotsgestaltung erfolgt auf der Grundlage einer gesundheitsbezogenen Sozialraumanalyse, vor dem Hintergrund eines umfassenden Prozesses der Gesundheitsförderung und Prävention. Typische Beispiele sind etwa Gesundheitskurse und Lebensstilinterventionen, aber auch das (Fall-)Management von chronischen Erkrankungen, wie Diabetes oder Herzkreislauferkrankungen. Im Vordergrund steht die Stabilisierung des ursächlichen Gesundheitsproblems durch Ressourcenförderung, Rehabilitation und professionelle Pflege, und weniger die Behandlung isolierter Symptome.
Neben einer kommunal verorteten Steuerung der Angebotsstruktur erfordert dies eine Aufgabenneuverteilung unter den Professionellen im Gesundheitswesen. Hierbei gilt es einerseits bestimmte Berufsgruppen gezielt zu entlasten, um mehr Ressourcen für deren Kernkompetenzen zu schaffen (z.B. Diagnostik und Pharmakotherapie bei Ärzten), und andererseits bestimmte Aufgaben zwischen den Disziplinen zu teilen, um eine Angebotskumulation zu erreichen (z.B. Wundversorgung, Check-ups, Gesundheitskurse, Fallmanagement). Auf diese Weise könnten beispielsweise knappe Personalressourcen effektiver und effizienter eingesetzt – und die Angebotsstruktur im lokalen Sozialraum bedarfsgerechter ausgestaltet werden.
GVSG – Gute Ansätze aber ausbaufähig
Der Entwurf zu dem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz (GVSG) beinhaltet viele gute Ansätze und wichtige Schritte in diese Richtung. Erklärte Zielsetzung des Entwurfs ist die Stärkung der Gesundheitsversorgung in den Kommunen, sowie die Erhöhung der individuellen Gesundheitskompetenz der Bürgerinnen und Bürger.
Um besser auf bestehende Bedarfe vor Ort reagieren zu können, sollen die Kommunen mehr Einflussmöglichkeiten auf die lokale Angebotsstruktur und Versorgungsplanung erhalten. Im Ergebnis soll damit auf eine gesundheitliche Chancengleichheit hingewirkt werden, gerade für sozial oder strukturell benachteiligte Regionen. Eine Stoßrichtung, die wir als Deutsches Rotes Kreuz nur unterstützen können.
Zu diesem Zweck sollen z.B. Gesundheitskioske, Gesundheitsregionen und Primärversorgungszentren geschaffen werden, was im Kern zu begrüßen ist, aber im Detail noch der Nachschärfung bedarf. Als Wohlfahrtsverband sehen wir insbesondere in den Gesundheitskiosken eine Möglichkeit unsere Ressourcen konstruktiv miteinzubringen. Wünschenswert wäre daher die aktive Beteiligung der Freien Wohlfahrtspflege als Betreiber dieser neuen Versorgungsangebote.