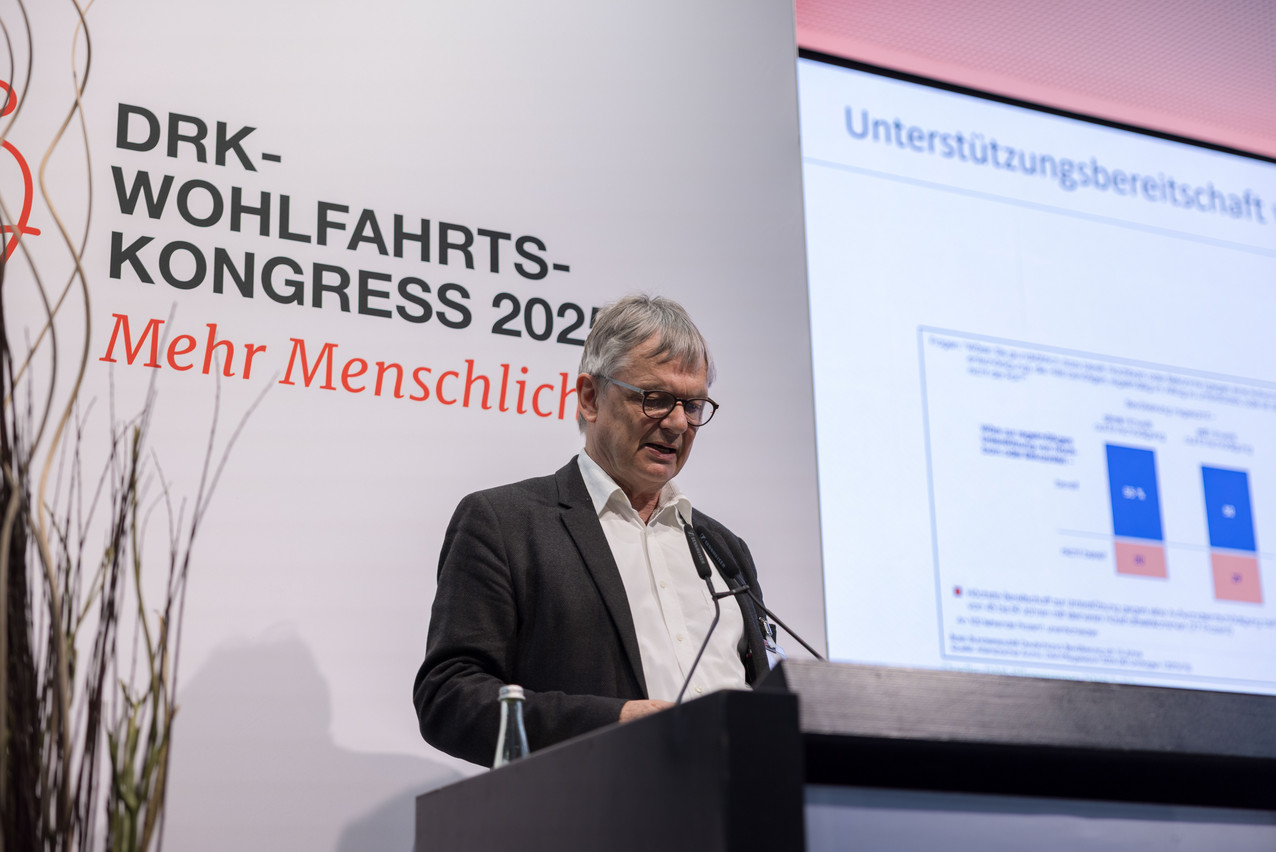
Versorgung sichern, Menschlichkeit stärken – Impulse vom DRK-Wohlfahrtskongress 2025

Versorgungssicherheit ist eine zentrale Herausforderung für unsere Gesellschaft – welche Rolle spielt das Subsidiaritätsprinzip dabei?
Prof. Dr. Klie: Versorgungssicherheit in einem fachlichen Sinne, in Sinne der Einlösung sozialstaatlicher Gewährleistungsfunktionen, bleibt eine staatlich zu organisierende Aufgabe. Nicht umsonst sprechen wir von Caring Communities, von sorgenden Gemeinschaften – nicht von „versorgenden“. Die Sorge, die sicherlich eine Menge von Versorgung auffangen kann, indem sie Versorgung im engeren Sinne subsidiär denkt und gestaltet, sie ist eine kulturell zu verankernde und gesellschaftlich zu organisierende und wahrzunehmende Aufgabe. Es gibt Interdependenzen zwischen Versorgung und Sorge. Nur Versorgungssicherheit in einem fachlichen Sinne bleibt eine staatlich zu verantwortende Aufgabe. Insofern hat verlässliche Sorge und Beziehungsarbeit keinen unmittelbaren Versorgungsbezug. Gesellschaftliche Solidarität, alltägliche reziproke Unterstützungsstrukturen: In sie gilt es zu investieren im Sinne eines weitgefassten Subsidiaritätsverständnisses, das eine staatliche Vorleistungspflicht kennt, um die Sorgefähigkeit einer Gesellschaft zu unterstützen, zu ermöglichen und dort, wo sie nicht verfügbar ist, zumindest auf Zeit zu kompensieren.
Welche strukturellen Veränderungen sind nötig, um eine verlässliche soziale Infrastruktur zu sichern – insbesondere angesichts des demografischen Wandels?
Prof. Dr. Klie: Daseinsvorsorge ist kein Rechtsbegriff, sondern ein verwaltungswissenschaftlicher Begriff – mit einer schillernden Geschichte. Forsthoff hat ihn im Dritten Reich als Lebensbedingung für die Volksgenossen beschrieben. Wir haben ihn in der Nachkriegszeit weiter genutzt und in unser Verfassungsset integriert. Daseinsvorsorge im verwaltungswissenschaftlichen Sinne, das haben wir im Zweiten Engagementbericht der Bundesregierung intensiv diskutiert und herausarbeiten lassen, heißt zunächst einmal Bedingungen guten Lebens für alle Bürgerinnen und Bürger schaffen.
Das Ringen um Bedingungen guten Lebens für alle Bürgerinnen und Bürger ist Kern unserer Demokratie (vor Ort).
Es gibt wenige Daseinsvorsorgeaufgaben, die als Pflichtaufgaben der Kommunen geregelt sind: Abwasser- und Wasserversorgung etc. pp. Die Sorge um den anderen und die Voraussetzung für die Sorgefähigkeit der örtlichen Gesellschaft gehört in jedem Fall zur Daseinsvorsorge, aber nicht unbedingt in dem Sinne, dass die Kommune diese Aufgaben selbst wahrzunehmen hat.
Bei der Gestaltung von Daseinsvorsorgeaufgaben, die hier nur auf einem Mix von informeller, nachbarschaftlicher, zivilgesellschaftlicher, marktlicher und staatlicher Aktivität beruht, wird man die modernen Bedingungen des Zusammenlebens mitzureflektieren haben.
Man wird nicht mehr - wie das Nell-Breuning noch getan hat – auf die konzentrischen Kreise einer von einer patriarchalen Familienstruktur ausgehenden Familienverantwortung Subsidiarität entwickeln können. Jeder trägt das ihm Gemäße zur Gestaltung einer Gesamtaufgabe bei: Das in diesem Sinne jedem Gemäße gilt es vor Ort herauszuarbeiten, aber auch auf der Metaebene Bilder von diesem Zusammenwirken zu entwickeln.
Der Mangel an Pflege- und Betreuungskräften gefährdet die Versorgungssicherheit vielerorts. Welche Lösungsansätze sehen Sie, um dem entgegenzuwirken?
Prof. Dr. Klie:Insbesondere der Fachkräfterückgang respektive Mangel verlangt nach einem kompetenzorientierten Einsatz von Fachpflegepersonen, aber auch anderen Professionellen wie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Insofern wird sicherlich auch das DRK gut daran tun, sich an den Diskursen und Verhandlungen zu beteiligen, die ein kompetenzorientierten Einsatz von Pflegefachpersonen auch im Sozialleistungsrecht vorsehen und unterstützen. Das gilt sowohl für das SGB V als auch für das SGB XI. Davon kann derzeit noch keineswegs ausgegangen werden. Dort muss die Eigenständigkeit der Professionellen gestärkt werden. Sie dürfen nicht in die betrieblichen Kalküle von gewerblichen, aber auch freigemeinnützigen Entitäten eingezwängt werden. Was die sogenannten Betreuungskräfte anbelangt – sozialarbeitswissenschaftlich ist der Betreuungsbegriff ein No-Go – also von Assistenzkräften, wie wir in der Teilhabetradition sehen, wird man viel stärker auf polyvalente Akteure setzen, ihre Kompetenzen wahrzunehmen und in einem Hilfemix mitzuberücksichtigen haben.
Was haben die Corona-Pandemie und andere aktuelle Krisen über die Verwundbarkeit unserer sozialen Versorgungssysteme gezeigt?
Prof. Dr. Klie: Die Pandemie hat insbesondere gezeigt, auf welche militärischen Traditionen das deutsche Gesundheits- und Pflegewesen im Krisenfall bereit ist, zurückzugreifen - und dies unter Missachtung von menschenrechtlichen Grundpositionen. Es wurde weiterhin deutlich, dass wir für Notfall- und Pandemiekonstellationen nicht vorbereitet sind, oder – weder hinsichtlich der entsprechenden Kompetenzen noch hinsichtlich einer entsprechenden Ausstattung mit Hilfsmitteln etc. pp. In dreierlei Hinsicht wären aus Corona Konsequenzen zu ziehen: Zum einen in Sachen Haltung, Menschenbild- und Menschenrechtsorientierung, zum anderen hinsichtlich eigenverantwortlicher Abwägungskompetenzen hinsichtlich der zu händelnden Risiken zwischen Infektionsschutz einerseits und (psychischer) Gesundheit der Betroffenen andererseits. Schließlich bedarf es eines systematischen Wissens über Ressourcen, auch in personeller Hinsicht. Davon sind wir weit entfernt und darauf basieren Notfallpläne und ein Notfallmanagement, im Sinne einer Desaster Management-Grundkompetenz.
Jeder trägt das ihm Gemäße zur Gestaltung einer Gesamtaufgabe bei – das gilt es vor Ort herauszuarbeiten.






